Forschungsthemen und Methodik
Die Entwicklung eines nationalen Sicherheitsforschungsinstituts im KIRAS-Projekt SFI@SFU sieht sich der Verfolgung und Weiterentwicklung der vom Nationalen Sicherheitsrat definierten sicherheitsbezogenen Ziele der Republik Österreich verpflichtet und möchte einen essentiellen Beitrag zur (weiteren) wissenschaftlich fundierten Ausgestaltung sicherheitspolitischer Konzepte leisten. Methodisch durch einen umfassenden Ansatz (comprehensive approach) geleitet, verfolgen wir die Weiterentwicklung von Sicherheitsforschung in diesem übergeordneten Rahmen.
Wir widmen uns der systematischen Analyse menschlicher (individueller wie sozial vermittelter) Bedürfnisse und sehen darin einen wesentlichen Beitrag zur Erhebung des Bedarfs an Sicherheit als öffentlichem Gut und der sozialen Akzeptanz technischer Lösungen für Sicherheitsprobleme. Diesem Feld zwischen subjektiver Wahrnehmung von (Un-)Sicherheit in der österreichischen Bevölkerung und objektivierbarer Sicherheitslage gilt besondere Aufmerksamkeit, vor allem im Hinblick auf die Optimierung der Krisen- und Risikokommunikation (der öffentlichen Hand) in Extremsituationen.
Wir sind uns bewusst, dass kulturelle Faktoren großen Einfluss auf Handlungsmotivationen, kognitives Wissensmanagement und Risikowahrnehmung haben und eine entscheidende Rolle in der Erzeugung gesellschaftlicher Sicherheit in und für Österreich spielen. Im Rahmen fachübergreifender Risikoforschung sollen daher kultur- und bewusstseinsbezogene Kriterien für die Kritikalität von Infrastruktur entwickelt werden, darüber hinaus geht es auch um eine Erforschung (gesamt-)gesellschaftlicher Auswirkungen bei Ausfall von Kritischer Infrastruktur im Zusammenhang mit dem Spannungsfeld zwischen security und integrity.
„Sicherheit“ ist immer auch als gesellschaftlich vermittelter Prozess zu sehen. Für die Sicherheitsforschung ergibt sich daraus die Aufgabe, über die Entwicklung rein technischer bzw. bloß technisch machbarer Sicherheitslösungen und Produkte hinauszugehen und deren Verortung im Herzen der Gesellschaft zu untersuchen. Dies geschieht durch die Integration der Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften (GSK). Diese leisten in mehrfacher Hinsicht einen wesentlichen Beitrag:
-
Bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe, Sicherheit als Öffentliches Gut zur Verfügung zu stellen, steht der Staat vor den Fragen: Wie nehmen Bürgerinnen und Bürger Risiken in ihrem Alltag wahr? Welches sind die vorherrschenden Bedrohungsszenarien? Und stimmt all das mit „objektiven“, statistisch erhobenen und belegbaren Risikowahrscheinlichkeiten überein? Und was bedeutet das für künftige Beschaffungs- und Umsetzungsmaßnahmen von Sicherheitslösungen – wie hat die Öffentliche Hand darauf zu reagieren?
-
Indem die GSK das subjektive Sicherheitsempfinden thematisieren und untersuchen, liefern sie auch wesentliche Aufschlüsse über fehlende oder vorhandene Technikakzeptanz der Bevölkerung – welche Sicherheitslösungen werden als tatsächlich notwendig oder wünschenswert bewertet? Wo entsteht der Eindruck, es handle sich um einen massiven oder nicht hinnehmbaren Eingriff in die Privatsphäre bzw. eine Beschneidung verfassungsgesetzlich garantierter Grundfreiheiten?
-
Technikfolgenabschätzung dient dem Ziel, mögliche negative gesellschaftliche Auswirkungen oder Risiken neuartiger Sicherheitstechnologien zu minimieren. Sie untersucht auch Technologietrends und deren möglichen Zusammenhang mit gesellschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Entwicklungen und bietet so auch die Chance der Prävention von Risiken und der Reduktion von Gefährdungspotenzialen.
Aufgrund der großen Bedeutung der Thematik widmen wir uns auch Fragen der Technikpsychologie. Dabei soll der Erkenntnisstand der Technikpsychologie um einen Fokus auf sicherheitsbezogene Fragestellungen erweitert werden. In einer daraus folgenden, integrativen technikpsychologischen Forschung wird eine Analyse der relevanten Sicherheitsbedürfnisse (security needs) auf Erzeuger- und Anwenderseite mit einbezogen. Das technikpsychologische Erkenntnisinteresse richtet sich dabei insbesondere auf Aspekte der Gebrauchstauglichkeit (human usability) technologischer Lösungen für Sicherheitsprobleme und deren psychische Auswirkungen auf das Individuum und auf den sozialen Überbau von Risikowahrnehmung (Angstprozesse, fear of crime, privacy u.a.m.).
Im Bereich der Krisen- und Katastrophenforschung wollen wir einen Beitrag zum Schritt von der Panik- zur Resilienzforschung leisten, die nicht auf das Unterdrücken, sondern auf das Fördern adaptiven individuellen und kollektiven menschlichen Handelns in Katastrophenfällen ausgerichtet ist. Ziel muss es letztlich sein, die Widerstandsfähigkeit der Bevölkerung zu erhöhen.
Das KIRAS-Prokjekt SFI@SFU umfasst folgende Arbeitspakte (Abbildung 1):
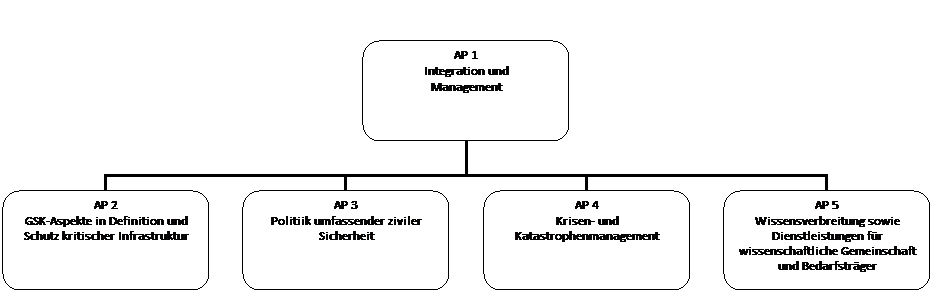
Abbildung 1: Arbeitspaketstruktur des KIRAS-Projekts SFI@SFU.
Im Rahmen der fachlich-inhaltlichen Arbeitspakete 2, 3 und 4 stehen folgende Zielsetzungen im Vordergrund:
GSK-Aspekte in Definition und Schutz Kritischer Infrastruktur (AP2)
Die systematische Analyse menschlicher (individueller und sozial vermittelter) Bedürfnisse ist ein wichtiger Bestandteil der Erhebung des Bedarfs an Sicherheit als öffentliches Gut und der sozialen Akzeptanz technischer Lösungen für Sicherheitsprobleme. Sie gibt Aufschlüsse über das Verhältnis von (Un-)Sicherheitsperzeption zur objektivierbaren Sicherheitslage und liefert Grundlagen für die Optimierung von Risiko- und Krisenkommunikation der öffentlichen Hand sowie zur Effizienzsteigerung präventiver und interventionistischer Maßnahmen. Im Speziellen soll im Rahmen dieses Arbeitspaketes die Erforschung der gesellschaftlichen Auswirkungen bei Ausfall von Kritischen Infrastrukturen vorangetrieben sowie im Rahmen des umfassenden Ansatzes von KIRAS der Begriff „weiche“ kritische Infrastruktur elaboriert werden, zu dem Aspekte wie Resilienz und das Spannungsverhältnis zwischen security und integrity (insbes. liberale Freiheitsrechte und demokratische Legitimität von Entscheidungen über sicherheitssteigernde Maßnahmen) zu zählen sind.
Politik umfassender ziviler Sicherheit (AP 3)
Das KIRAS-Programmdokument beschreibt Sicherheit als öffentliches und zugleich von der öffentlichen Hand bereitzustellendes Gut. Im Lichte dessen bedürfen staatswissenschaftliche Aspekte von Sicherheit der österreichischen Bürger/-innen einer breiten Aufarbeitung. In diesem Arbeitspaket sollen deshalb – auch im Vergleich der internationalen zur österreichischen Perspektive – relevante Forschungsstränge im Bereich zivile Sicherheit mit dem integrativen Ansatz gesamtstaatlicher Sicherheitsforschung verknüpft werden. Ebenso soll eine thematische Verbindung zu Herausforderungen einer wissenschaftlichen Analyse vor dem Hintergrund eines comprehensive approach im Dienste der Sicherheit aller Bürger/-innen hergestellt werden. Dazu gehört Grundlagenarbeit zur Forschungslogik und Methodik. Hierbei wird auch – in Einschätzung der Übertragbarkeit auf Österreich – auf Konzepte und Ergebnisse der Sicherheitsforschung im 7. EU-Forschungsrahmenprogramm zurückgegriffen.
Krisen- und Katastrophenforschung (AP 4)
Es ist ein wichtiger Bestandteil dieses Arbeitspaketes, praktisch aufgreifbare wissenschaftliche Grundlagen für die präventive und prospektive Änderung von Verhaltensdispositionen zu ermitteln. Der Mainstream der Katastrophenforschung konzentriert sich außerdem unter dem Leitbegriff consequence management auf die zweite Hälfte des Ereignishorizonts (ab der Reaktion auf den Schadenseintritt). Consequence management muss sich auch auf bestimmte alltagsweltliche und katastrophenkulturelle Grunddispositionen in einer Gesellschaft stützen können. Deshalb beginnt consequence management bereits vor dem Ereigniseintritt, und gerade in diesem Sinn ist es ein Bestandteil von Sicherheitsforschung. Ziel ist deshalb die Klärung insbesondere folgender Aspekte: (1) Kommunikativer und informativer Zugang zum Bürger in mitigation, preparedness und response; (2) Wandel und Stabilisierung von Sicherheitskulturen (kulturelle Faktoren bei der Herausbildung spezifischer Verhaltens- und Erwartungsmuster); (3) Einbeziehung der europäischen Dimension und in einer daraus resultierenden vergleichenden Analyse zum österreichischen System.
SFI@SFU-Methodik
Interdisziplinär kombinierte Forschungsteams bearbeiten die jeweiligen Arbeitspakete und arbeitspaketspezifischen sowie -übergreifenden Aufgaben, wobei die Arbeiten jeweils unter der Leitung eines/einer interdisziplinär ausgewiesenen/r Experten/-in synoptisch synchronisiert werden. Dadurch wird konsolidiertes integriertes Zusammenwirken der beteiligten Fachrichtungen in einem gemeinsamen Rahmen als Grundlage für die Entwicklung des Sicherheitsforschungsinstituts erzielt und über die Schaffung einer administrativen Plattform, die dann in einzelnen Projekten Expertise einbindet und Ergebnisse interdisziplinärer Forschung verbreitet, hinausgegangen. Vielmehr wird die Grundlage für eine nachhaltige Tätigkeit bereitet, die in integrierter Arbeit von Sicherheitsforschen/-innen besteht.
Darüber hinaus nimmt ein Beratungsgremium (Beirat) an den Arbeiten begleitend teil, der aus wesentlichen Bedarfsträgervertretern besteht und direkter Bestandteil des Projekts ist. Insbesondere vermittelt der Beirat auch weitere Expertise, um zum Beispiel im Rahmen von bereits wiederholt durchführten Bedarfsträgerworkshops gemeinsam fachübergreifenden Wissensbedarf zu identifizieren, der in Rahmen der Ziele und Aufgaben des Projekts gedeckt werden kann.
Des Weiteren verfügt das Projekt SFI@SFU mit dem Arbeitspaket 5 über einen Rahmen, um Bedarfsträger und weitere stakeholder, insbesondere aus der Sicherheitswirtschaft, direkt in die Forschungsarbeit und die Konzeption der Ergebnisse sowie der Art ihrer Vermittlung und Verbreitung einzubeziehen. Dies geschieht vor allem auch in Form von selbst konzipierten und ausgerichteten Workshops, in denen die Mitarbeiter/‑innen des Projekts gemeinsam mit externen Experten/-innen produktiv zusammenarbeiten und bedarfsgerechte Ergebnisse entwickeln.
Die nachstehende Abbildung 2 fasst die Arbeitsprozess-Struktur des Projekts SFI@SFU zusammen.
Abbildung 2: Arbeitsprozess-Struktur des KIRAS-Projekts SFI@SFU.
Ausgewählte Literaturhinweise zur Methodendiskussion der Sicherheitsforschung
Baker, G.W./D.W. Chapman (Hg.): Man and Society in Disaster. New York: Basic Books, 1962.
Balzacq, T.: Securitization Theory. How Security Problems Emerge and Dissolve. London: Routledge, 2011.
Bieber, R. u.a.: Sicherheitsforschung – Begriffsfassung und Vorgangsweise für Österreich. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2005.
Burgess, P. (Hg.): The Routledge Handbook of New Security Studies. London u.a.: Routledge, 2010.
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT), Stabsstelle für Technologietransfer und Sicherheitsforschung: Programmdokument für alle Programmlinien des Programmes KIRAS. Wien, September 2008, http://www.kiras.at/fileadmin/dateien/allgemein/KIRAS_Programmdokument_04_2009_08.pdf (letzter Zugriff: 23.08.2010).
Carlos Martí Sempere: The European Security Industry. A Research Agenda, in: Defence and Peace Economics 22:2 (2011), S. 245-264.
European Security Research Innovation Forum (ESRIF): ESRIF Final Report. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities 2009, http://www.esrif.eu/documents/esrif_final_report.pdf (letzter Zugriff: 23.08.2010).
Felgentreff, C./W.R. Dombrowsky: Hazard-, Risiko- und Katastrophenforschung, in: Carsten Felgentreff/Thomas Glade (Hg.): Naturrisiken und Sozialkatastrophen. Heidelberg: Spektrum, 2008, S. 13-29.
Geiger, G.: Sicherheit oder Sicherheitstechnologie. Der Beitrag der zivilen Forschung zur Sicherheit Europas. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit, 2010 (SWP-Studie; S 14), http://swp-berlin.org/common/get_document.php?asset_id=7094 (letzter Zugriff: 23.08.2010).
Hutzschenreuter, T./T. Griess-Nega (Hg.): Krisenmanagement. Grundlagen, Strategien, Instrumente. Wiesbaden, 2006.
lwang, J./P.B. Siegel/S.L. Jorgensen: Vulnerability: A View From Different Disciplines. Social Protection Discussion Paper Series; 0115. World Bank, 2001, http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Social-Risk-Management-DP/0115.pdf (letzter Zugriff: 23.08.2010).
Kaufmann, F.-X.: Sicherheit als soziologisches und sozialpolitisches Problem. Stuttgart: Enke, 1970.
Kloepfer, M.: Schutz kritischer Infrastrukturen. IT und Energie. Baden-Baden: Nomos, 2010.
McEntire, D.A.: Searching for a Holistic Paradigm and Policy Guide, in: International Journal of Emergency Management 1 (2003), S. 298-308.
McEntire, D.A.: Disciplines, Disasters and Emergency Management. The Convergence and Divergence of Concepts, Issues and Trends from the Research Literature. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 2007; zugleich: Washington, DC: Federal Emergency Management Agency, E-Book, 2006, http://training.fema.gov/emiweb/edu/ddemtextbook.asp (letzter Zugriff: 23.08.2010).
Meeting the Challenge: The European Security Research Agenda. A Report from the European Security Research Advisory Board. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006, http://ec.europa.eu/enterprise/security/doc/esrab_report_en.pdf (letzter Zugriff: 23.08.2010).
Mileti, D./T. Drabek/J. Haas: Human Systems in Extreme Environments. A Sociological Perspective. Boulder, CO: University of Colorado, Institute of Behavioral Sciences, 1975.
Münkler, H./M. Bohlender/S. Meurer (Hg.): Sicherheit und Risiko. Über den Umgang mit Gefahr im 21. Jahrhundert. Bielfeld: transcript, 2010.
Riescher, G. (Hg.): Sicherheit und Freiheit statt Terror und Angst. Perspektiven einer demokratischen Sicherheit. Baden-Baden: Nomos, 2009.
Sicherheitsforschung. Austria Innovativ, Spezialausgabe; 3a/2008, http://www.austriainnovativ.at/downloads/SIFO.pdf (letzter Zugriff: 23.08.2010).
Siedschlag, A./D. Silvestru/F. Fritz/M. Andexinger/K. Becher: Ergebnisse empirisch-analytischer Arbeiten (Befragungen, Bedarfsanalysen und sonstige Erhebungen) im KIRAS-Projekt SFI@SFU. Studie - S 3, Mai 2011 (letzter Zugriff: 17.05.2011).
Slovic, P. The Perception of Risk. London/Sterling, VA: Earthscan, 2000.
Winzer, P./E. Schnieder/Friedrich-W. Bach (Hg.): acatech DISKUTIERT. Sicherheitsforschung – Chancen und Perspektiven. Berlin u.a.: Springer, 2010, http://www.acatech.de/fileadmin/user_upload/Baumstruktur_nach_Website/Acatech/root/de/Publikationen/acatech_diskutiert/acatech_diskutiert_Sicherheitsforschung_Innenseiten_DRUCK_X4.pdf (letzter Zugriff: 27.03.2011).
Zoche, P./S. Kaufmann/R. Haverkamp (Hg.): Zivile Sicherheit: Gesellschaftliche Dimensionen gegenwärtiger Sicherheitspolitiken. Bielefeld: Transcript, 2010.
(sfi-sfu.eu – 18.08.2011)