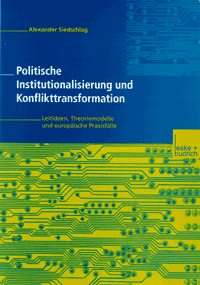 Alexander
Siedschlag
Alexander
Siedschlag
Politische Institutionalisierung und Konflikttransformation
Leitideen, Theoriemodelle und europäische Praxisfälle
(Überarbeitete Fassung der Habilitationsschrift, Humboldt-Universität
zu Berlin, WS 1999/2000.)
Opladen: Leske
+ Budrich, 2000
494 S., zahlr. Abb., 88,- DM
ISBN 3-8100-2633-6
Leitthema der Untersuchung sind die Voraussetzungen, Strategien und (intendierten ebenso wie nicht-intendierten) Folgen kooperativer Konfliktregelung durch Institutionalisierung. Institutionalisierung interessiert als Weg zu meliorativer Konflikttransformation - und damit nicht nur zu Konfliktbearbeitung und Problemlösung in Einzelfällen, sondern vor allem zu verbesserter genereller Konfliktkompetenz (zum Beispiel einem gemeinsamen Grundverständnis von und über Konflikt, gemeinsamen Regelungsideen und entsprechenden gemeinsamen Praxisverfahren sowie geschulter Kompromißfähigkeit). Was bedeutet Institutionalisierung als politische Konfliktstrategie und auch als Analyseperspektive konkret, was sind ihre Praxisverfahren, Erfolgsbedingungen, Nebenwirkungen und Gegenanzeigen, für welche Typen von Konflikt und für welche Anwendungsfenster erscheint sie besonders geeignet, für welche weniger? Um das zu beantworten, wird das erreichbare theoretisch-methodische Repertoire für kooperative Konfliktregelung durch Institutionalisierung dargestellt, für die Konfliktanalyse wie für die Fragen von politischer Konfliktstrategie erschlossen und an europäischen Praxisfällen durchdekliniert.
Dabei ergibt sich zunächst: Institutionalisierung als politische Institutionalisierung bedeutet die Umsetzung einer jeweils bestimmten Regelungsordnung mit bestimmten Leitideen und Prinzipien. Das Besondere am Prozeß politischer Institutionalisierung ist, daß er im Grundsatz kein interaktionszentrierter Institutionalisierungsmodus, keine "Evolution der Kooperation" (Robert Axelrod) ist, sondern daß es um die Geltungsvermittlung kollektiver Entscheidungssysteme geht, um die Umsetzung von vereinbarten Prinzipien und die Schaffung von gemeinsamen Problemlösungsarenen. Politische Institutionalisierung formt sich keine Wirkkontexte, sondern sie bedarf existierender: Leitideen, Prinzipen und politische Normen als solche kann man nicht institutionalisieren; sie sind vielmehr die Voraussetzung für Institutionalisierung. Institutionalisierung, insbesondere als Konfliktstrategie, ist deswegen weder wesentlich gut noch schlecht, weil der Institutionalisierungsprozeß als solcher nichts Hinreichendes über die zugrundeliegenden Leitideen, Prinzipien und Normen aussagt.
Als gemeinsamer Nenner über die Vielzahl neo-/institutionalistischer Theoriebeiträge hinweg lassen sich fünf Komponenten politischer Institutionalisierung festhalten. Zunächst die Herstellung typischer Handlungskontexte (Erwartungsverläßlichkeit, Luhmannsche "Erwartungserwartungen" und Reziprozitätsnormen), typischer Handlungen (gemeinsame Verfahrensweisen) und typischer Akteure. Es zeigt sich aber, daß politische Institutionalisierung als Konfliktstrategie zwei weitere Komponenten erfordert - einen Wirkmechanismus und einen Reproduktionsmechanismus der kooperativen Konfliktregelung. Wirkmechanismus vor allem im Sinn einer doppelten Übersetzungsleistung: der repräsentativen Abbildung des Konflikts in den Regelungskontext und der Rückübersetzung der dort erzielten Ergebnisse in den realpolitischen Prozeß. Reproduktionsmechanismus besonders, was die politische Anschlußfähigkeit der Konfliktregelungsleistung und ihrer Leitideen angeht.
Ihren jeweiligen Leitideen nach verlaufen kann Institutionalisierung nur dann, wenn einerseits die darin angelegten Akteurstypengruppen real vorhanden und ansprechbar sind und wenn die Konflikte andererseits regelmäßig auftreten. Wiederkehrende Konflikte sind keine Hemmnisse, sondern entscheidende Ansatzpunkte für Institutionalisierung - Institutionalisierung bedarf des Weiterlaufens von Konflikt. Deswegen gehört es zu Institutionalisierung als Konfliktstrategie, kontinuierlich zu prüfen, inwieweit ihre Funktionsvoraussetzungen noch gegeben sind und die Repräsentation des Konflikts noch den Realitäten entspricht.
Es läßt sich eine Reihe allgemeiner Anwendungsprinzipienbzw. Erfolgsvoraussetzungen politischer Institutionalisierungsstrategien der Konfliktregelung beschreiben:
In einem anderen Zusammenhang, der Institutionalisierung konfliktstabiler und konfliktfähiger Demokratie, wird die Schwierigkeit transferorientierten Institutionendesigns deutlich. Solch ein Institutionalisierungsmodus steht in der Gefahr, zu konfliktverschärfender Überinstitutionalisierung zu führen. Zum Beispiel in Form durchaus starker Normgeltung, jedoch ohne ihren Prinzipien folgende Funktionalität - insofern sie etwa maßgeblich von den Stimmungslagen einzelner Spitzenakteure oder von Interessenkartellen abhängig ist, die ihre eigenen Prinzipien einführen.
Hier ist besonders gut ersichtlich, was auch allgemeiner gilt: Politische Institutionalisierung, namentlich durch Institutionentransfer, benötigt passende Akteurstypen, in spezifische Regelungskontexte übersetzbare Konflikte und geeignete politisch-gesellschaftliche Übersetzungsstrukturen, ebenso wie eine angemessene Repräsentation der Konflikte in der jeweiligen institutionellen Regelungsarena. Sonst führt Institutionalisiertheit der Konfliktregelungsversuche erwartbar, zumal wenn eingespielte gemeinsame Verfahrensrepertoires noch weitgehend fehlen, zu in ihrer Wirkung schlecht abzusehenden Symbolressourcen des Konfliktaustrags und fortgesetzt zu Konfliktkapitalbildung statt zu meliorativer Transformation. Mit solcher Konfliktinduktion durch Institutionalisierung ist aber auch dann zu rechnen, wenn im Rahmen von Institutionalisierungsprozessen eingespielte Funktionsbezüge verwischt oder durch neue überlagert werden. Das führt zu Prinzipienkonflikten oder ebenfalls zu Konfliktkapitalbildung, wie es beides innerhalb des Visegrád-Prozesses zu beobachten war.
Über alle betrachteten europäischen Praxisfälle hinweg,
insbesondere jedoch im Fall der politischen Institutionalisierung eines
Gesamteuropas (im OSZE-Rahmen) ist klar geworden, daß gegebene politische
Realitäten und politische Erbschaften viel eher Pfade für Institutionalisierungspolitiken
vorzeichnen, als das gemeinsame Leitideen oder problemfunktionale Zuschnitte
tun. Insgesamt hat sich gezeigt, daß kooperative Konfliktregelung
durch Institutionalisierung, wenn sie politisch nachhaltig zum Durchbruch
kommt, eine zugleich starke und sensible Strategie ist. Sie
führt zu merklichen und beharrenden Akteurstypenbindungen, Pfadprägungen
und Konflikttransformationen, aber der Toleranzbereich, in dem all
das den intendierten Effekten entspricht, erweist sich immer wieder als
recht eng.
Weiterführende Hinweise:
Neoinstitutionalismus als Konfliktstrategie - Möglichkeiten und Grenzen von Institutionalisierungsverfahren der politischen Konfliktregelung. Arbeitspapier, Humboldt-Universität zu Berlin, Juni 2002.
Political
Institutionalization and Conflict Management in the New Europe - Path-Shaping
for
the
Better or Worse? Arbeitspapier für die 97. Jahrestagung der American
Political Science
Association (APSA), San Francisco, 30. August - 2. September 2001.
Institutionalization and Conflict Management in the New Europe. Arbeitspapier für den 18. Weltkongreß der International Political Science Organization, Quebec City, Kanada, 1.-5. August 2000.