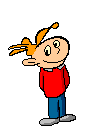 Alexander
Siedschlag
Alexander
Siedschlag 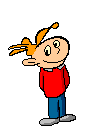 Alexander
Siedschlag
Alexander
Siedschlag
Einige Hinweise zu Formfragen schriftlicher Forschungsarbeiten
(Für inhaltliche Gestaltungsaspekte wird auf
die im jeweiligen Semesterordner zu findende Zusammenstellung von Hinweisen
verwiesen.)
Diese Hinweise sind als Orientierungsvorschläge für diejenigen
zu verstehen, die noch nach einem System
für die Gestaltung ihrer Arbeiten suchen bzw. an Ratschlägen
interessiert sind, nicht etwa als verbindliche Formvorschriften.
Rigide Reglementierungen für Formalia von Hausarbeiten aufzustellen ist sowieso sinnlos, weil das Prinzip der Gegenstandsadäquanz je nach bearbeitetem Sachverhalt und zugrunde gelegten Fragestellungen Unterschiede auch in den Formalia wissenschaftlicher Forschungsarbeiten bedingt. Dennoch erscheint es erfahrungsgemäß sinnvoll, folgende Formnormen größenordnungsmäßig einzuhalten:
Rand nach allen Seiten ca. 3 cm, was zu einer Satzspiegelbreite ("Zeilenlänge") von ca. 15 cm und einer Satzspiegellänge (Länge des gedruckten Textes auf einer Seite) von ca. 24 cm zzgl. Seitenzahl führt. Schriftgrad 12 Punkt (Fußnotentext kann 10 Punkt groß sein). Durchschuß ("Zeilenabstand") 1 ½ Zeilen. Bei Manuskripten sollte die Seitenzahl oben und zentriert gesetzt werden, ohne einschließende Striche (z.B. kein - 2 -, sondern 2). Die Titelseite ist Seite 1, wird aber nicht numeriert. Die Titelseite enthält immer auch die vollständige Autorenanschrift, das Semester und das Abgabedatum. Das Inhaltsverzeichnis beginnt auf Seite 2 und trägt ebenfalls keine Seitenzahlen. Erst ab der ersten Seite des eigentlichen Textes fängt die Numerierung an. Zu jedem Punkt im Inhaltsverzeichnis wird wie bei einem Buch die entsprechende Seitenzahl aus dem Haupttext angegeben (ohne "S.").
Immer wieder anzutreffende inhaltslose Inhaltsverzeichnisse der Art:
1. "Einleitung"
2. "Hauptteil"
3. "Kritische Schlußbetrachtung"
4. "Ausblick"
sind sinnlos, weil hier überhaupt nichts über die Inhalte ausgesagt wird. Besser sind sachliche statt formal-argumentationsstruktureller Angaben (wobei obige Vierteilung freilich sehr wohl als Strukturmuster dienen kann), wie etwa:
1. Vom Realismus zum Neorealismus - Überblick über das Thema
2. Die sechs Grundlagen des klassischen Realismus nach Hans J. Morgenthau
3. Revisionen und Ergänzungen: Synoptischer Realismus, Struktureller
Realismus, Ökonomischer Realismus
4. Aktuelle Trends neorealistischer Theoriebildung - neue Anknüpfungen
an den klassischen Realismus
5. Probleme und Potentiale neorealistischer Analyse nach der Bipolarisierung.
Werden Unterpunkte gemacht, so ist darauf zu achten, daß unter keinem Oberpunkt nur ein Unterpunkt stehen darf: Es gibt z.B. kein "1.1" ohne mindestens noch ein "1.2".
Das auch die Note möglicherweise beeinflussende Grundprinzip formal richtiger Gestaltung der Arbeit ist das Kriterium der Einheitlichkeit. Für welche Zitierweise Sie sich entscheiden (klassisch in Fußnoten oder integrierter Kurzbeleg, d.h. "amerikanisch"), ist z.B. weit weniger bedeutsam als daß dies auch einheitlich durchgehalten und nach einem erkennbaren durchgängigen Muster zitiert wird. Es ist ein gravierender formaler Fehler, einfach unsystematisch zu jedem zitierten Werk diejenigen Angaben anzuführen, die Sie gerade haben, also mal Ort und Verlag, mal nur den Ort, mal die ausgeschriebene Verfassernamen, mal abgekürzte Vornamen usw. Entscheiden Sie sich am Anfang - nicht nur bei der Zitierweise - für ein Muster und halten Sie dieses durch!
Werden Fußnoten verwendet, so ist darauf zu achten, daß Fußnoten wie Sätze behandelt werden; d.h. jede Fußnote beginnt mit einem Großbuchstaben und endet mit einem Punkt. "Siehe", "Vgl." usw. kann als Hinweis für eine eher weiter aufzufassende Sinnentsprechung durchaus angemessen und nötig sein, sollte aber nicht jargonhaft verwendet werden. Für einen normalen, direkten Beleg genügt die Nennung der Quelle ohne irgendwelche einleitenden Floskeln. Grundlegend und allen nachdrücklich empfohlen zu den Formalia der Zitierweise, der Erstellung des Literaturverzeichnisses u.ä. ist das DUDEN-Taschenbuch von Klaus Poenicke "Wie verfaßt man wissenschaftliche Arbeiten?", das wohlfeil in so gut wie allen Buchhandlungen zu haben und von bleibendem Wert ist.
Sinnlos ist es, in Fußnoten Verfassernamen zu invertieren (den Nachnamen vor den Vornamen zu stellen). Das macht man nur in "Aufzählungen", also in Ihrem Fall im Literaturverzeichnis. Das Literaturverzeichnis gehört an den Schluß jeder Seminararbeit und enthält alle im Text zitierten Titel mit einem Punkt am Ende und ohne einleitende Spielstriche u.ä. Monographien, Beiträge in Monographien, Zeitschriftenaufsätze, Dokumente oder was auch immer - alles was im Text zitiert wird, gehört ins Literaturverzeichnis. Dagegen legt es leidvolle Erfahrung mit hochstapelnden Hausarbeiten nahe, zu verlangen, daß nur solche Materialien im Literaturverzeichnis erscheinen, auf die auch tatsächlich im Text Bezug genommen wird. Die früher oft verfochtene akademische Regel, ins Literaturverzeichnis alles aufzunehmen, wovon man in Zusammenhang mit seiner Thematik irgendwie profitiert hat, kann angesichts der Lesefäule (oder -unfähigkeit) immer mehr Studierender nicht mehr propagiert werden.
Es ist Humbug, bestimmte zahlenmäßige Vorgaben für die Gestaltung eigenständiger Forschungsarbeiten (wozu wohlgemerkt auch akademische Hausarbeiten zählen sollen) zu machen. Dennoch gibt es einige gute Erfahrungswerte. Bei einem Gesamtumfang von weniger als 15 Seiten gelingt es den wenigsten, ihr Thema in der für eine Note besser als "befriedigend" nötigen Breite und Tiefe abzuhandeln. Gleiches gilt für eine Literaturgrundlage von erheblich weniger als 15 Titeln (Bücher, Aufsätze und Quellenmaterialien zusammengenommen). Eine vernünftige Belegdichte für den laufenden Text hat man sicher dann erreicht, wenn pro Seite ca. 5 Belege auftauchen (aber nicht immer aus ein und demselben Buch ...).